Die Technologiebranche boomt. KI, Cloud, Chips – überall hört man von exponentiellem Wachstum und riesigen Chancen. Wer da nicht investiert, ist doch selber schuld… oder?
Immer mehr Anleger packen ihr Geld in spezialisierte Branchen-ETFs – meist getrieben von dem Gefühl, die Zukunft erkannt zu haben. Doch genau hier liegt das Problem: Die Vergangenheit zeigt uns ziemlich eindeutig, dass das gezielte Setzen auf eine bestimmte Branche in den wenigsten Fällen funktioniert.
In diesem Artikel erfährst du, warum das „Gewinnerbranche finden“-Spiel nicht nur extrem schwer, sondern oft sogar kontraproduktiv ist – und was du stattdessen tun solltest.
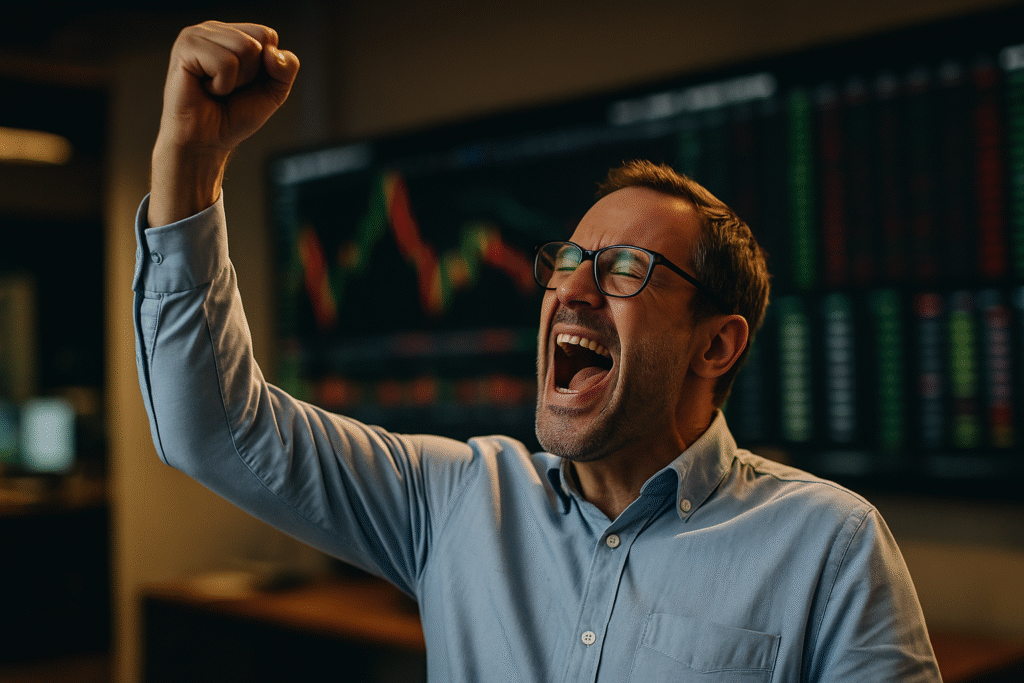
Warum es so schwer ist, die Gewinnerbranche zu finden
Es klingt verlockend: Man analysiert Trends, hört auf Experten und investiert in die Branche, die künftig die Welt dominieren wird. Die Realität ist jedoch ernüchternd.
1. Branchen verändern sich ständig
1900 waren es Eisenbahngesellschaften und Banken, die die Börsen dominierten. Heute sind es Tech-Giganten. Branchen kommen und gehen – das nennt man „kreative Zerstörung“. Neue Technologien verdrängen alte, ganze Industrien verschwinden, während andere entstehen. Diese Dynamik ist gesund für die Wirtschaft – aber tückisch für Investoren.
2. Die Top-Branche von heute ist selten die von morgen
Ein Blick auf die vergangene Börsengeschichte zeigt ein klares Muster: Branchen, die in einem Jahrzehnt außergewöhnlich gut performen, landen im darauffolgenden Jahrzehnt selten wieder an der Spitze. Im Gegenteil – viele von ihnen schneiden danach sogar deutlich schlechter ab als der Gesamtmarkt. Analysen über mehrere Jahrzehnte hinweg zeigen, dass die jeweils führenden Branchen im Folgejahrzehnt im Schnitt rund 2,6 % pro Jahr hinter dem Markt zurückbleiben. Wer also auf aktuelle Gewinner setzt, läuft Gefahr, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein.
3. Der Markt preist Erwartungen ein
Wenn alle glauben, dass eine Branche die Zukunft ist, sind die Kurse dieser Unternehmen oft schon entsprechend hoch. Die Aktie eines Unternehmens reflektiert nicht den aktuellen Zustand, sondern die Erwartungen an die Zukunft. Und je höher die Erwartungen, desto schwieriger wird es, diese zu übertreffen.
4. Branchenwachstum ≠ Aktienrendite
Nur weil eine Branche wächst, heißt das nicht, dass auch die Aktienrenditen steigen. Ein gutes Beispiel: Die Tech-Branche mag insgesamt enorme Gewinne erzielen – aber diese verteilen sich auf viele Unternehmen, oft mit massiver Kapitalaufnahme (Aktienausgabe). Die Folge: Verwässerung. Am Ende ist das entscheidende Maß nicht das Wachstum der Branche, sondern das Wachstum des Gewinns pro Aktie.
Anlegerverhalten verschärft das Problem – und kostet Rendite
Selbst wenn eine Branche langfristig gute Renditen erzielen könnte, scheitern viele Anleger trotzdem daran, von dieser Entwicklung zu profitieren. Warum? Weil ihr Verhalten sie immer wieder in die falsche Richtung steuert. Drei psychologische Fallstricke stehen dabei besonders im Weg:
1. Performance-Chasing – der Herdentrieb an der Börse
Viele Anleger investieren nicht dann in einen Sektor, wenn er günstig und unbeliebt ist, sondern erst dann, wenn er bereits eine starke Performance hinter sich hat. Es ist ein typisches Verhalten: Man sieht, dass Technologie, Gesundheit oder erneuerbare Energien in den letzten Jahren stark gestiegen sind – und möchte diesen Erfolg „nachholen“.
Doch genau das ist der Fehler. Der Großteil der Kursgewinne liegt bereits hinter uns, und die Bewertungen sind oft deutlich gestiegen. Der Einstieg erfolgt also zu einem Zeitpunkt erhöhter Erwartungen und gestiegener Risiken. Kaum ist man investiert, kommt die Korrektur – und viele Anleger steigen dann aus Enttäuschung oder Angst wieder aus. Dieses Verhalten wird in der Forschung als „Performance-Chasing“ bezeichnet – also dem blinden Hinterherlaufen vergangener Renditen.
Besonders bei sogenannten Sektor-ETFs, die gezielt auf einzelne Branchen wie Tech oder Energie setzen, ist dieses Verhalten weit verbreitet. Anleger steigen auf dem Höhepunkt der Euphorie ein – und verkaufen nach Rücksetzern. Ein gefährlicher Kreislauf, der oft zum Kapitalverlust führt.
2. Die Renditelücke – „Mind the Gap“
Eine der eindrücklichsten Studien zu diesem Thema ist der jährlich erscheinende „Mind the Gap“-Report von Morningstar. Die Version von 2024 zeigt ein klares Bild: Bei Branchen- und Sektor-ETFs beträgt die durchschnittliche Differenz zwischen der Fondsrendite und der tatsächlichen Anlegerrendite satte minus 2,6 % pro Jahr – über einen Zeitraum von zehn Jahren.
Was heißt das konkret?
Während der Fonds selbst eine gute Performance erzielt, verpassen viele Anleger diese Erträge, weil sie zu spät einsteigen und zu früh verkaufen. Die Renditelücke entsteht durch schlechtes Timing – und dieses Timing ist oft eine direkte Folge von emotionalen Entscheidungen, nicht rationalem Handeln.
Die durchschnittliche Anlegerin oder der durchschnittliche Anleger verdient also deutlich weniger als der ETF selbst abwirft, nur weil sie dem Markt zu sehr „zuhören“ – sprich: sich von Medien, Trends oder dem Verhalten anderer leiten lassen.
3. Technologie-Fokus: Eine reale Fallstudie
Ein besonders extremes Beispiel für dieses Phänomen bietet der Technologie-Sektor, insbesondere der NASDAQ-Index. In Phasen starker Kursanstiege – etwa während des Booms rund um Künstliche Intelligenz oder während der Corona-Pandemie – fließt massiv Kapital in Tech-ETFs. Anleger kaufen genau dann, wenn die Bewertungen auf historischen Höchstständen sind.
Was folgt, ist oft eine Korrektur oder zumindest eine Phase der Seitwärtsbewegung – und viele Anleger reagieren mit Verkaufsentscheidungen aus Unsicherheit oder Enttäuschung. Das Ergebnis: Laut einer Studie aus der renommierten American Economic Review lag die durchschnittliche Anlegerrendite im NASDAQ etwa 5,3 % pro Jahr unter der Indexrendite – ein dramatischer Unterschied, der sich allein durch Fehlverhalten beim Timing erklären lässt.
Dieser sogenannte Return Gap ist kein Zufall, sondern ein strukturelles Problem im Anlageverhalten. Und er zeigt, warum auch „zukunftsträchtige“ Branchen für Anleger zur Falle werden können – einfach, weil sie zu spät aufspringen und zu früh abspringen.
Warum breit gestreutes Investieren besser funktioniert
1. Breite Diversifikation reduziert Risiken
Das gezielte Investieren in eine Branche ist mit hohen, oft unkompensierten Risiken verbunden. Wenn eine Branche aus regulatorischen oder technologischen Gründen unter Druck gerät, leidet das gesamte Investment.
2. Der Vorteil von Indexfonds und ETFs
Ein breit aufgestellter ETF (z. B. MSCI World oder ein All Country World Index) enthält automatisch die Branchen, die gerade wachsen – und lässt die anderen nach und nach herausfallen. So bleibt man automatisch bei den relevanten Unternehmen investiert, ohne selbst Branchenwetten eingehen zu müssen.
3. Einzelaktienrisiko vermeiden
Investiert man nur in eine Branche, ist man extrem abhängig von einzelnen Unternehmen. Bei einem breit gestreuten ETF hingegen wird das Risiko über Hunderte oder Tausende Firmen verteilt. Das reduziert das Risiko erheblich, ohne auf Renditechancen zu verzichten.
Was tun, wenn man trotzdem mehr Rendite will?
Nachvollziehbar: Wer langfristig investiert, stellt sich früher oder später die Frage, ob mehr Rendite möglich ist – ohne dabei gleich ins Risiko von Branchenwetten oder Einzelaktien zu rutschen. Die gute Nachricht: Es gibt bessere Wege, die eigene Anlagestrategie gezielt zu verbessern – wissenschaftlich fundiert und ohne spekulative Manöver.
Faktorinvesting: Systematisch besser anlegen
Statt zu versuchen, die nächste Gewinnerbranche zu erraten oder „den nächsten Amazon“ zu finden, gibt es eine elegantere Lösung: Investieren mit Faktoren. Faktoren sind bestimmte Eigenschaften von Aktien, die in der Vergangenheit zu systematisch höheren Renditen geführt haben – und das über Jahrzehnte, Märkte und Regionen hinweg.
Zu den bekanntesten Renditefaktoren gehören:
- Value: Aktien von Unternehmen, die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten (z. B. Gewinn, Umsatz oder Buchwert) besonders günstig bewertet sind.
- Size (Small Cap): Aktien von kleineren Unternehmen, die tendenziell stärker wachsen können – wenn auch mit etwas mehr Schwankung.
- Quality: Unternehmen mit stabilen Gewinnen, gesunder Bilanz und hoher Kapitalrendite.
- Momentum: Aktien, die in letzter Zeit stark gestiegen sind, tendieren dazu, kurzfristig weiterzusteigen (funktioniert v. a. in Trendphasen).
Diese Faktoren lassen sich über ETFs abbilden, was bedeutet: Du musst keine einzelnen Aktien auswählen. Stattdessen kannst du dein Portfolio gezielt so strukturieren, dass es langfristig etwas höhere Renditen erwarten lässt – ohne ins Spekulieren abzurutschen.
Fazit: Du brauchst keine Wetten – du brauchst System
Die Geschichte der Finanzmärkte zeigt deutlich: Branchen kommen und gehen. Wer heute auf den Sieger von morgen setzt, liegt oft daneben – und zahlt dafür mit Renditeeinbußen, Timing-Fehlern und unnötigem Stress.
Die bessere Strategie? Investiere breit, kostengünstig und langfristig. Nutze evidenzbasierte Konzepte wie Faktorinvesting, um gezielt mehr Renditepotenzial zu erschließen – aber ohne dein Portfolio zu konzentrieren oder riskante Wetten einzugehen.
Wenn du in die Weltwirtschaft investierst, profitierst du automatisch davon, dass Unternehmen wachsen, sich weiterentwickeln und – wenn nötig – von neuen ersetzt werden. Du musst nicht die Zukunft vorhersagen. Du musst nur dabei bleiben.
Call to Action:
Du willst wissen, wie du ohne Branchenwetten klug investierst?
Dann abonniere meinen Substack-Newsletter „FrankenInvest“ – dort bekommst du fundiertes Finanzwissen, ehrlich, unabhängig und verständlich erklärt. Für alle, die ihr Geld langfristig sinnvoll anlegen wollen.
Folge mir auch auf X (vormals Twitter) unter [@frankeninvest], wo ich regelmäßig Impulse rund um Geld, Leben und sinnvolles Investieren teile.
Weiterlesen auf FrankenInvest:
Disclaimer
Die Inhalte auf FrankenInvest dienen ausschließlich der allgemeinen Information und Finanzbildung. Sie stellen keine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die dargestellten Strategien und Meinungen spiegeln meine persönliche Sichtweise wider und ersetzen keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson.
Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bevor du Investitionsentscheidungen triffst, informiere dich umfassend und ziehe bei Bedarf professionelle Unterstützung hinzu – insbesondere, wenn es um deine persönliche finanzielle Situation geht
